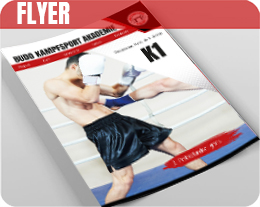K1 ist sehr vielfältig, da es Techniken aus verschiedenen Kampfsportarten wie Muay Thai, Thaiboxen, Taekwondo und Kickboxen miteinander kombiniert.
Beim Training werden nicht nur die Schlagkraft, sondern auch die Ausdauer und Schnellkraft, aber auch die Disziplin und die Körperbeherrschung geschult.
Du liebst es dich mit Anderen gemeinsam auszupowern? Dann bist du in der Budo Kampfsport Akademie genau richtig!
 |
 |
 |
| K1 Trainingszeiten sind: Montag und Mittwoch 18:15 – 20:00 Uhr. | |||
|